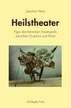Die finale Fassung dieses Textes erschien im Kleist-Jahrbuch 2014, S. 205-212.
Die Grenze Kleist[1]
Traut man jüngeren forschungsgeschichtlichen Standortbestimmungen, befindet sich die Reflexion über das barocke Trauerspiel eines Andreas Gryphius in einer Phase umfassender Neuorientierung. Die vertraute »Pendelbewegung«[2] zwischen Lektüren, die sich den Dramen über die (souveränitäts‑)theoretischen Konstrukte der politischen Theologie nähern, und solchen, die sie auf ihre christlichen Traditionsbestände hin befragen, sorgt – so darf man aus derlei Diagnosen wohl schließen – inzwischen für eine gewisse Ermüdung. ›Dritte Wege‹, die abseits der »Paradigmen von Politik und Heilsgeschichte«[3] verlaufen, sind also gefragt.
Nimmt man diese sehr grobe Kartierung zum Ausgangspunkt, liegt der Anfangsverdacht nahe, ›Heilstheater‹ bewege sich exakt in einem dieser (mutmaßlich) ausgetretenen Pfade, reaktiviere nur mehr die seit Albrecht Schönes bekannten Studien intensiv geführte Debatte um typologische Deutungsmuster im Trauerspiel. Dem – so sei vorgegriffen – ist aber nicht so. Es handelt sich bei Joachim Harsts Untersuchung, einer komprimierten, stark überarbeiteten Fassung seiner 2010er Dissertation, um eine gedanklich dichte, ambitionierte, pointiert geschriebene und bisweilen sprachlich glänzende Studie, deren Innovationspotential sich nicht zuletzt den Durchblicken verdankt, die aus der Konfrontation historisch und generisch disparater Untersuchungsgegenstände resultieren. Zwar erfreuen sich Qualifikationsarbeiten, die Gryphius und Kleist im Titel führen, mittlerweile einer gewissen Beliebtheit,[4] nicht immer ist die Konjunktion der – sei es in einer geheimen ›Verwandtschaft‹, sei es im Kontrast oder in einer literaturgeschichtlichen Entwicklung verbundenen – Autoren dabei allerdings ganz einleuchtend. Hier hingegen entspricht sie mit strenger Folgerichtigkeit der systematischen Anlage der Arbeit. Denn die ›Figur des barocken Trauerspiels zwischen Gryphius und Kleist‹ bezeichnet durchaus kein diachrones Zwischen, das vielleicht gar die (oder eine) Geschichte des ›barocken Trauerspiels‹ von Gryphius an bis auf Kleist zu erzählen erlaubte. Sie zielt vielmehr auf eine »Grenze« (S. 14), die Gryphius und Kleist zusammenführt wie trennt, und die Harst als Grenze zwischen Repräsentation und Theatralität beschreibt. So stehen Repräsentation und Theatralität sich zunächst als die Untersuchung strukturierende Oppositionsbegriffe gegenüber: Setzt die eine zwingend die Möglichkeit strikter, mit ›Gesetzeskraft‹ befestigter Unterscheidung voraus, ›theatralisiert‹ die andere dieses Begehren der stabilen Differenz durch Mechanismen der ›Entscheidung‹. Äußert sich die eine im »Wille[n]« des Trauerspiels (S. 66), die Sphären von Sein und Schein, von Gut und Böse, von Märtyrer und Tyrann sauber zu dividieren, ›enttäuscht‹ die andere dieses Phantasma klarer Unterschiede, indem sie die Unterscheidung in den Wirkungsbereich des Scheins hineinzieht, mithin den Schein entgrenzt:
»Hier würde das Gesetz nicht die Szene rahmen und abgrenzen, sondern selbst Teil des Spiels, Produkt des sich in ihm verwirklichenden Begehrens sein: Es handelte sich um ein entgrenztes Theater, in dem das Gesetz eben nurmehr eine Rolle spielt und dessen Szene daher in einem unentschiedenen Schein steht.« (S. 20)
Das verführt freilich zu einer naheliegenden, sehr schlichten Identifikation: Wäre Gryphius’ Trauerspiel der ›Repräsentation‹ zuzuordnen, Kleists Schreiben als ›theatral‹ zu charakterisieren? Die Problematik ist, wie Harst darzulegen sucht, bei weitem komplexer: Auf der einen Seite zeitigt der »Wille« des Trauerspiels, insofern er auf die repräsentative Schließung des Systems der Unterschiede gerichtet ist, ›ungewollte‹ theatrale Folgeeffekte; auf der anderen Seite funktionieren Kleists Entgrenzungsverfahren nur in spezifisch repräsentativen Konstellationen. Die ›Figur‹ des barocken Trauerspiels wäre also gleichsam der ›Grund‹, vor dem die Theatralität Kleists Kontur gewinnt.
Entsprechend »flankier[en]« (S. 193) den Gryphius gewidmeten Hauptteil der Arbeit (»Figur«) zwei (freilich nicht minder ›zentrale‹) Kleist-Kapitel (»Fall« und »Erfüllung«), die sich der Analyse eben dieser Konstellationen widmen. Konkretisieren lassen sich letztere für den ersten Teil mit einem von Deleuze und Guattari geprägten Begriff als das »›Aussagegefüge[ ]‹« der ›Berliner Abendblätter‹, »das neben Redaktion und Publikum eben auch Nationaltheater und Zensur umfaßt« (S. 21). Mit Ifflands Berliner Nationaltheater und der Kleists Zeitungsprojekt bekanntlich arg zusetzenden Zensurbehörde gehen hier zwei Instanzen des Gesetzes, zwei Anwälte der Fixierung von Zeichenprozessen in ein Spiel ein, das Harst treffend als »Theaterkritik« analysiert. Als »Schreibstrategie« (S. 29) ist ›Theaterkritik‹ zugleich Kritik am Theater und theatrale Kritik, ein Versuch, das von höchster Stelle autorisierte Projekt, »dem Königreich Preußen im Nationaltheater eine Repräsentanz zu schaffen, deren Heiligkeit dank der Zensur zumindest im Sinne der Unantastbarkeit gewährleistet wäre« (S. 34), zu unterwandern – und zwar, indem die Theaterkritik gewissermaßen an der Funktionsbedingung von Zensur, nämlich der definitiven Trennung von Kritik und Objekt der Kritik, ansetzt: Schon der Verlauf des sogenannten ›Theaterskandals‹ vom 27. November 1810 unterläuft die Unabhängigkeit von ›Fall‹ und ›Sprechen über den Fall‹, wird doch das Ereignis, über das die ›Abendblätter‹ berichten, durch ihren Redakteur Kleist maßgeblich mitverursacht – eine signifikante »Rückkopplung von Redaktion und Publikum« (S. 35), die sich darüber hinaus geradezu als »mediale Strategie« (S. 35) der ›Abendblätter‹ geltend macht: Wenn fingierte Leserbriefe den Rückbezug auf dort gar nicht geäußerte Kritik ermöglichen, ja diese ins Leere gehende Referenz ihrerseits im Modus der kritischen Bezugnahme inszenieren, fallen Äußerung und Zurücknahme von Kritik im selben Sprechakt zusammen. Die (fingierte) Kritik von Kritik zerstört ihr Objekt in dem Moment, in dem sie es generiert und macht sich so für eine Zensur letztlich unangreifbar, die eine theatral aufgehobene Unterscheidung nicht zu fassen bekommt. Die Kehrseite der ›Theaterkritik‹ bildet indes eine unhintergehbare Zweideutigkeit, die sie dem Urteil verleiht. Zwischen ›echtem‹, ›authentischem‹ Lob und ironisch vorgebrachter Kritik lässt sich nicht mehr unterscheiden, wo auch die »›Wahrheit‹ des Textes [...] allein dank der Lüge« (S. 34) erscheint: »Lob« und sein »Gegensatz« (S. 35) – beide können sich im Aussagegefüge der ›Abendblätter‹ stets als Täuschung erweisen.
Dieser hier noch sehr konkrete Sinn von ›Theaterkritik‹ wird im Voranschreiten der Untersuchung durch Engführung mit dem Begriff des ›Gottesurteils‹ erheblich erweitert. In teils sehr kompakten Lektüren ausgewählter Anekdoten, des Essays ›Über das Marionettentheater‹ und der Erzählungen ›Der Findling‹ und ›Der Zweikampf‹, schärft Harst den Blick für die medialen Erscheinungsbedingungen von Transzendenz. Immer wieder, so fällt dabei auf, tauchen die medialen Eigenlogiken des Offenbarungsträgers (etwa im ›Griffel Gottes‹) die scheinbar eindeutigen Botschaften in ein theatrales Zwielicht, das eine endgültige Aussage darüber, was der Fall gewesen ist, unmöglich macht. Auf die Spitze getrieben wird dieses Verfahren im ›Zweikampf‹: Statt den Fall (genauer: das Nicht-stattgefunden-Haben des Falls) festzustellen, vervielfältigt das im ›Theater‹ des Zweikampfs sich verhüllende Gottesurteil den Fall bloß. Neben dem Fall Littegardes steht plötzlich auch der »Unfall« und »Zufall« Friedrichs zur Entscheidung – ohne allerdings im Gottesurteil abschließend entschieden zu werden:
»Entsprechend ist das Gottesgericht ein »Unfall«, der den Schein nicht auflöst, sondern in der produzierten Spiegelung (FallFall) ihn erst zur absoluten Unentscheidbarkeit radikalisiert. Diese ist jedoch nicht im Sinn beliebiger Ununterscheidbarkeit zu verstehen, sondern als Forderung der Unterscheidung unter Bedingung ihrer Unmöglichkeit.« (S. 56)
So wäre denn dem auf Repräsentation verpflichteten Trauerspiel auf der einen Seite eine Grenze gesteckt im Kleistschen Entzug des Falls. Die zweite ›Flanke‹ besetzt Harst mit der Aufhebung der Figur im Schein. Während der Fall unter Bedingungen der Repräsentation eine Unterscheidung zu begründen hat, die dem figuralen Muster von Verheißung und Erfüllung, Typos und Antitypos vorausgeht, bringen sich Fall und Erfüllung im ›Zerbrochnen Krug‹ wechselseitig hervor. Unmittelbar anschaulich wird dies am intertextuellen Erbe, das Richter Adam – »bereits als Name eine komische Figur« (S. 179) – mit sich führt: Er ist Repräsentant des Sündenfalls und dessen figuraler Aufhebung zugleich, wenn er den »leidgen Stein zum Anstoß« – mithin, in Anspielung auf 1 Petr 2,8, den Christus – »in sich selbst« (I, Vs. 5–6[5]) sucht, eine figürliche Figur, wenn man so will (S. 179). Ihre heilsverbürgende Funktion büßt die Figur damit selbstredend ein, zumal in einem Spiel, das den vor Gericht verhandelten Fall nur ›figürlich‹ zu rekonstruieren vermag – in Gestalt eines seltsam gestaltlosen Kruges, einer bloß scheinbar (mit dem Krug) ›zerbrochenen‹ Unschuld oder eines – vielleicht, vielleicht auch nicht – von links nach rechts wandernden, ödipalen Schwellfußes. Solche Detailbeobachtungen, die in der Kleist-Forschung freilich in Teilen bereits gemacht wurden, integriert Harst gekonnt in einer Lektüre, die auf die konsequente, nahe an die Unaufführbarkeit heranreichende Unanschaulichkeit des Stückes abhebt. Mit der Unanschaulichkeit der auf anschauliche Evidenz angewiesenen Figur gerät hier neben dem Fall auch die Erfüllung ins Wanken, nicht nur das ›Dass‹ des Sündenfalls von Adam und Eve, auch die Wiederherstellung von Unschuld rückt in den Bezirk unauflösbaren Scheins. Das hat Konsequenzen für die Gattung des Spiels: Denn trotz gemeinsamer Problemstellung mit dem Trauerspiel (Heilsversicherung und Unschuldsbeweis) verkehrt die »Virtualität des Falls« (S. 191) und ihrer Auflösung das Trauer- ins Lustspiel. »Der Sündenfall als unausweichliche Komödie vereinigt Gott und Teufel, kann Unschuld nur im Schein wiederherstellen.« (S. 190)
In diesen von der doppelten Grenze Kleist terminierten Umriss, der theatralen Verunsicherung von Fall und Erfüllung, fügt sich etwas, das Harst Trauerspiel nennt. Ergänzt man dies um die Erläuterung, dass man darunter weniger eine historische (etwa aus zeitgenössischen Poetiken rekonstruierte) Gattungsbezeichnung als vielmehr eine »Denkform« sui generis verstehen solle (S. 193), Lust- und Trauerspiel als »Extremformen« zu nehmen habe, »deren sich der Einzeltext in der Realisation seines Begehrens bedient« (S. 20), so stellt sich unwillkürlich die Vermutung ein, dass Harsts Untersuchung begrifflich näher an Walter Benjamins Trauerspiel-Buch operiert, als sich am terminologischen Usus einer Barockforschung zu orientieren, die in Teilen Benjamins Habilitationsschrift noch immer kaum mit der Kneifzange anpackt. Und tatsächlich besteht ein nicht geringes Verdienst von ›Heilstheater‹ darin, obschon es das andauernde Schisma[6] mit Sicherheit nicht auflösen kann (geschweige denn will), nichtsdestoweniger einen signifikanten Beitrag zur ›Völkerverständigung‹ von Barock- und Benjaminforschern zu leisten. Beides hängt (auch) mit der methodischen Zwiefältigkeit der Studie zusammen: In ihr korrespondiert dem oben beschriebenen Schema, das Harst als brillanten Arrangeur von Lektüren ausweist, die eminent textnahe, aufmerksame Analysearbeit der Einzelabschnitte. Die ›Denkform‹ Trauerspiel scheint, aus dieser Perspektive betrachtet, induktiv Profil zu bekommen und die gegen Benjamins Methodik und Erkenntnisinteresse vorgebrachten Vorbehalte mit skrupulöser Argumentation am Trauerspiel-Text (im historischen Sinne) zu kontern. Gleichwohl harmonisiert ein solcher Eindruck vorschnell die Reibungen, die sich zwischen Lektüre und Schema auch hier einstellen, und auf die ich gleich zu sprechen komme. Das Schema kann – naheliegenderweise – nicht ohne Rückwirkungen auf die Gestalt der ›Denkform‹ bleiben und markiert somit, gerade indem es ohne Zweifel eine theologische Problembearbeitung (als die sich das Trauerspiel gibt) exponiert, die Grenzen des eigenen Blickfeldes. Das ist unumgänglich. Die Frage wäre, welches Maß derjenigen Gewalt, die noch jede Lektüre kennzeichnet, sich hier kundtut.
Doch vorerst zur ›Figur‹ der ›Denkform‹ Trauerspiel. Von den Rändern der Studie her gesehen muss sie sich in einem ersten Schritt als das glatte Gegenteil der grenzüberschreitenden, scheinaffinen Schreibstrategie Kleists darstellen: Getragen vom »ostentative[n] Wille[n] zur Eindeutigkeit« (S. 66) tendiert das Trauerspiel zu klaren Grenzziehungen, die die Ermöglichungsbedingung seiner heilsversichernden Darstellungsintention bilden. Die Insistenz, mit der etwa in Gryphius’ ›Catharina von Georgien‹ der unumstößliche Entschluss der Protagonistin zum Martyrium modelliert, schließlich im rhetorisch erzeugten Ideal der ›Reinheit‹ und ›Keuschheit‹ bekräftigt wird, sei, so argumentiert Harst, symptomatisch für das Anliegen, in einer der Vergänglichkeit preisgegebenen Welt, einen Raum stabiler Bedeutung zu eröffnen. Nur das absolut Gute, an dessen evidenter, bühnenwirksamer Beglaubigung in der Figur des Märtyrers dem Trauerspiel deshalb gelegen ist, vermag schließlich die Umschlägigkeit der Bedeutungen, die gefährliche Nähe von Märtyrer und Tyrann, von Schuld und Unschuld zu arretieren. Im Extremfall des als Ehe mit dem himmlischen Bräutigam allegorisierten Märtyrertodes (bekanntlich eine Anlehnung an die Hohelied-Exegese) nimmt der Heilswille gar den Charakter einer »Rechtsverbindlichkeit« (S. 78) an: Wer sich dem paradoxen Reinigungsritual der Blutstaufe unterzogen hat, erwirbt – wie schlechterdings jeder Tote, der mit den Überzeugungsmitteln des findigen Rhetorikers als Nachfolger Christi glaubhaft gemacht werden kann – einen Anspruch auf »Teilhabe am Heil« (S. 78). Bis in die Feinheiten der elokutiven Form des Dramas – seinen Hang zur Parataxe, zur gleichmäßigen Stilhöhe, zur Antithese, der pathetischen Formel und dem Parallelismus – wirkt die »Heilsmechanik« (Alewyn) hinein: »Eben diese gedankliche Starre und der ihr entsprechende Wunsch nach Eindeutigkeit und Beständigkeit ist im Parallelismus als einem besonders auffälligen Stilmerkmal des Gryphius sedimentiert, das sein Vorbild in den erhabenen Tragödien Senecas findet.« (S. 93) Das Revival der älteren Stilanalysen von Richard Alewyn und Paul Stachel kann Harst in eine hochinteressante Deutung des Trauerspiels als »imitatio tragœdiæ« überführen (vgl. S. 84–96).
Sein vorzügliches Vergewisserungsinstrument findet das Heilstheater aber in der christlichen figura. An ihr gewinnt zudem jener Mechanismus besondere Anschaulichkeit, der das Oppositionssystem des Trauerspiels nolens volens in die theatrale Entgrenzung kippt, den mutmaßlichen Gegensatz von Repräsentation (Gryphius/ Trauerspiel) und Theatralität (Kleist/Lustspiel) dynamisiert: Seinen Platz auf der ›richtigen Seite‹ mag sich Karl I. im Carolus Stuardus wohl dadurch zu erstreiten suchen, dass er mit aller Macht in der figura Christi stirbt – das Trauerspiel gibt sich, wie man seit Albrecht Schöne weiß, jede erdenkliche Mühe, seine Majestät als imitator Christi vor die irdischen Richter zu führen. Tatsächlich erweist sich die Etablierung der figura bei genauer Lektüre allerdings als bewusster strategischer Spielzug des Königs und seiner Fürsprecher, das Heil, für das sie einzustehen beansprucht, als kontrolliert produzierbarer Effekt, mithin als wenig belastbarer Schein (vgl. S. 110). Mehr noch: Es zerbricht die ›Eindeutigkeit‹ des Trauerspiels an einer Paradoxie, die der von Karl bemühten figuralen Beziehung inhärent ist: Als schlagenden Beweis seiner Unschuld – freilich indisponible Voraussetzung der Nachfolge Christi – führt er die Unschuld der von ihm hingerichteten Widersacher Laud und Wentworth an. Somit ist »die Figur des königlichen Unschuldsopfers selbst […] an das von ihm begangene Unrecht gebunden, ja wird von ihm produziert, insofern seine Unschuld zunächst ein Abbild der Schuldlosigkeit Wentworths ist. Erst durch den ›Werkzeug‹ Wentworth kann Carolus zum Märtyrer werden.« (S. 114)
Dergleichen kluge Beobachtungen, stets kundig an den Stand der Forschung anschließend, ihn dabei in überaus originelle Wendungen treibend, sind es, die ›Heilstheater‹ zu einem starken, einem gelungenen Buch machen, zu einem, von dem über die spezialisierte Gryphius- oder Kleist-Forschung hinaus wichtige Anregungen ausgehen können: sowohl für eine allgemeine Poetik des Trauer- und Lustspiels als auch für das intrikate Wechselverhältnis von Theologie und Theater in der Frühen Neuzeit. Dass es Stoff zur Kontroverse birgt, ja seinerseits zum ›Stein des Anstoßes‹ taugt, hat weniger mit gewissen ›Rezeptionshürden‹ zu tun, die die Untersuchung aufbaut. So mögen sich die (›analytischer‹ gestimmten) Geister an der »bewußte[n] Mehrdeutigkeit« (S. 194) scheiden, mit der die Leitbegriffe ›Figur‹ (christliche figura, rhetorische Figur, Gestalt etc.) und ›Fall‹ (Sündenfall, Rechtsfall, Tatsache etc.) im Fortgang der Studie gebraucht werden. Terminologisches Schillern ist hier einerseits produktiver Reflex der Äquivokationen und Mehrdeutigkeiten ausbeutenden ›Objektsprache‹, könnte sich andererseits auf Überlegungen stützen, die für die Ebene wissenschaftlicher ›Metasprache‹ Bedeutungsüberschneidungen reklamieren.[7] Auch den Lebertran, den Harst dem einen oder anderen unkritischen Gryphius-Adepten mit zuweilen recht scharfen, nicht immer sachdienlichen Urteilen einschenkt (»weniger Eleganz und Raffinesse […] als die ›Kunstprosa‹ Cyprians«, S. 89; »der ›sermo humilis‹ der Evangelien und Apostelbriefe« werde bei Gryphius »zur erhabenen Rede ausgestopft«, S. 137), wird man schlucken können.
Auf Dunkelstellen der virtuosen Blickregie sich wechselseitig ›erhellender‹ und terminierender Textensembles verweist gleichwohl eine Unterscheidung, die Harst einführen, an der er festhalten muss, ohne sie im Rahmen der Arbeit (explizit) reflektieren zu können, weil sie sich gewissermaßen aus deren Grundarchitektur ergibt: Man bekommt sie in der erst einmal befremdlichen Formel »Verleugnung von Theatralität« (S. 193) zu greifen – laut Harst einer der auffälligen Züge seines ›barocken Trauerspiels‹: »[S]eine Repräsentation ist verleugnete Theatralität« (S. 13). Die »Konfrontation der Gryphschen Spiele mit ihren Grenzen hebt hervor, was das Trauerspiel mit aller Macht nicht sein will: Theatralisierung der Repräsentation als Überschreitung der mit göttlicher Autorität verbürgten Scheidung zwischen Schein und Sein.« (S. 193) Das ist nun in der Tat ›nur‹ Folge einer »Konfrontation« mit der Grenze Kleist, die sich durch Kleist gebrochen abzeichnende ›Figur‹ des Trauerspiels, schlechterdings ein aufschlussreiches optisches Spektakel. Die diese Figur erzeugende Figur – Harsts nicht umsonst in »Fall«, »Figur« und »Erfüllung« sich spaltende Arbeit – wiederholt damit strukturell und unvermeidlich jene Gewaltsamkeit, die sie an ihrem Gegenstand beobachtet: Soweit sie sichtbar ausstellt, ›unterdrückt‹ sie, weil anders ein Einrücken in die Figur nicht zu haben ist. So gibt sich die aus den Lektüren der Trauerspiele nicht mehr ableitbare Trennung von ›eigentlicher‹ Darstellungsintention und ›verleugneter‹ Nebenwirkung als ›Systemeffekt‹ zu erkennen, als Zerbrechen der Texte an der figural konstruierten ›Denkform‹. Der ›Wille‹ von ›Heilstheater‹, das figurale Schema zum eigenen Strukturprinzip zu machen, erzwingt es, ein Trauerspiel zu denken, das »Entgrenzung […] mit schwerem Ernst unterdrückt« (S. 193), dessen »gewaltsame Wunscherfüllung« bedingungslos »ernst gemeint« zu sein habe (S. 11) und dessen Theatralität sich nur im Zeichen ihrer Negation Bahn bricht: »Verleugnung« eben.[8] Das kann man und wird man ohne »Konfrontation« anders sehen.
Welche Zweifel sich ›von außen‹ am (offenkundig psychoanalytisch grundierten) Theorem des ›Verleugneten‹ und ›Unterdrückten‹ des Trauerspiels anmelden, zeigt sich – das überrascht nicht – am ›Unterdrückten‹ der Arbeit: Das sind einmal jene Textbeobachtungen, die allenfalls um den Preis einer (wahrlich) willkürlichen Unterscheidung noch den »ostentative[n] Willen zur Eindeutigkeit« (S. 66) bezeugen. Um es bei Andeutungen zu belassen: Die lapidare Bemerkung, dass Catharina von Georgien »sich bereits in den ersten Szenen« des Stückes »zum Sterben« entschlossen habe, ihr Martyrium ohne jedes »Ringen« antrete (S. 66), gerät durchaus in (unausgetragenen) Konflikt mit einem ganzen Strang der Gryphius-Forschung, der auf den instrumentellen Charakter des Martyriums im Trauerspiel, seine ›Politisierung‹ hinweist.[9] Inwiefern dann noch der Tod des Märtyrers (wenn er denn einer ist), die anschauliche Präsentation der Leiche, im Dienst besagten ›Willens‹ stehend, ›ungewollt‹ in Entgrenzung umschlägt, wäre gleichfalls in breiterem Kontext zu durchdenken: Zeugt nicht ein Kaiser Leo, der erschreckend wörtlich, noch dazu in einem »dreifache[n] Kalauer«[10], in der figura Christi, nämlich unter dem ›echten‹, leider nur zu ›unanschaulichen‹ Kreuz stirbt, ja durch seinen Tod ein Spiel der Deutungen entfacht, das ganz nachdrücklich im Stück ausgetragen wird, von einem anderen Trauerspiel? Von einem, dem der Schein nicht mehr schlicht im Tod zu überwindendes »Zeichen […] der Verworfenheit« wäre (S. 195)? Von einem, dessen Toleranzspanne für Ambivalenzen sich breiter ausnähme, das sich in der Folge jedoch der Umsetzbarkeit des Anspruchs, Heil mit den Mitteln des Theaters als gewiss vor Augen zu stellen, eben gar nicht mehr ›gewiss‹ sein wollte? Tritt man aus der ›Figur des barocken Trauerspiels‹ heraus, wird es am klügsten sein, bewusst keine Entscheidung zu treffen, was daran »Strategie«, was »Phänomen«[11] ist. Harsts ›Figur‹ muss sie treffen. Das ist es, was diese tatsächlich präzise zwischen Gryphius und Kleist platziert. Der ›schwere Ernst‹, den sie aus den Trauerspielen hebt, eine »Komik«, die »unfreiwillig« bleibt (S. 11), bis die Figur sich im Kleistschen Lustspiel »kaum mehr lustig[ ]« selbst auflöst (S. 179), wäre nicht zum wenigsten ihr eigener – und der des lesenden ›Willens‹, der sich in ihr bekundet.
[1] Über: Joachim Harst, Heilstheater. Figur des barocken Trauerspiels zwischen Gryphius und Kleist, München 2012, 216 S.
[2] Daniel Weidner, »Schau in dem Tempel an den ganz zerstückten Leib, der auf dem Kreuze lieget«. Sakramentale Repräsentation in Gryphius’ ›Leo Armenius‹. In: Daphnis 39 (2010), S. 287–312, hier S. 290. Ähnlich zur Polarisierung der Forschung das Resümee bei Franka Marquardt, Unerhört. Funktionen des Gebets in Andreas Gryphius’ ›Catharina von Georgien‹. In: Daphnis 37 (2008), S. 457–486, hier S. 457–463.
[3] Weidner, Sakramentale Repräsentation (wie Anm. 2), S. 292.
[4] Vgl. etwa die für Harsts eigenes Anliegen in vielem maßgebliche Vorläuferstudie von Christopher J. Wild, Theater der Keuschheit – Keuschheit des Theaters. Zu einer Geschichte der (Anti-)Theatralität von Gryphius bis Kleist, Freiburg i.Br. 2003, oder die teils komplementär zu lesende, parallel und unabhängig entstandene Dissertation von Barbara Natalie Nagel, Der Skandal des Literalen. Barocke Literalisierungen bei Gryphius, Kleist, Büchner, München 2012.
[5] Zitiert nach SW.
[6] Noch einmal sei Hans-Jürgen Schings’ vielzitierter Ordnungsruf, »Benjamin den Benjaminforschern und die barocken Trauerspiele den Barockforschern«, bemüht (Hans-Jürgen Schings, Walter Benjamin, das barocke Trauerspiel und die Barockforschung. In: Daß eine Nation die andere verstehen möge. Festschrift für Marian Szyrocki zu seinem 60. Geburtstag, hg. von Norbert Honsza und Hans-Gert Roloff, Amsterdam 1988, S. 633–676, hier S. 676).
[7] Zur ›Gestalthaftigkeit‹ der rhetorischen Figur vgl. beispielsweise Ralf Simon, Der poetische Text als Bildkritik, München 2009, bes. S. 251f.
[8] »Verleugnungen negieren Erfahrungen oder Einsichten, ohne sie jedoch ins Unbewusste zu verschieben« (Thomas Macho und Kristin Marek, Die neue Sichtbarkeit des Todes. In: Die neue Sichtbarkeit des Todes, hg. von Thomas Macho und Kristin Marek, München 2007, S. 9–21, hier S. 12). Harst gibt keine Auskunft, wie er den von Freud bis Derrida weithin diskutierten Begriff verstanden haben möchte.
[9] Vgl. exemplarisch Torsten W. Leine, Das Martyrium als Politikum. Religiöse Inszenierung eines politischen Geschehens in Andreas Gryphius’ ›Catharina von Georgien‹. In: DVjs 84 (2010), S. 160–175, hier S. 163–165, außerdem Albrecht Koschorke, Das Begehren des Souveräns. Gryphius’ ›Catharina von Georgien‹. In: Figuren des Europäischen. Kulturgeschichtliche Perspektiven, hg. von Daniel Weidner, Paderborn 2006, S. 149–162.
[10] Nagel, Skandal des Literalen (wie Anm. 4), S. 45. Nagel sieht in Leos Tod die »profanierte[ ] Version einer typologischen Struktur« realisiert (S. 46). Dass Harst weder auf den Leo Armenius noch auf Cardenio und Celinde zu sprechen kommt, gilt vor diesem Hintergrund als Aussage. Sie benennt die Grenzen der mit Kleist umrissenen ›Figur‹.
[11] Nagel, Skandal des Literalen (wie Anm. 4), S. 62.
Die Grenze Kleist[1]
Traut man jüngeren forschungsgeschichtlichen Standortbestimmungen, befindet sich die Reflexion über das barocke Trauerspiel eines Andreas Gryphius in einer Phase umfassender Neuorientierung. Die vertraute »Pendelbewegung«[2] zwischen Lektüren, die sich den Dramen über die (souveränitäts‑)theoretischen Konstrukte der politischen Theologie nähern, und solchen, die sie auf ihre christlichen Traditionsbestände hin befragen, sorgt – so darf man aus derlei Diagnosen wohl schließen – inzwischen für eine gewisse Ermüdung. ›Dritte Wege‹, die abseits der »Paradigmen von Politik und Heilsgeschichte«[3] verlaufen, sind also gefragt.
Nimmt man diese sehr grobe Kartierung zum Ausgangspunkt, liegt der Anfangsverdacht nahe, ›Heilstheater‹ bewege sich exakt in einem dieser (mutmaßlich) ausgetretenen Pfade, reaktiviere nur mehr die seit Albrecht Schönes bekannten Studien intensiv geführte Debatte um typologische Deutungsmuster im Trauerspiel. Dem – so sei vorgegriffen – ist aber nicht so. Es handelt sich bei Joachim Harsts Untersuchung, einer komprimierten, stark überarbeiteten Fassung seiner 2010er Dissertation, um eine gedanklich dichte, ambitionierte, pointiert geschriebene und bisweilen sprachlich glänzende Studie, deren Innovationspotential sich nicht zuletzt den Durchblicken verdankt, die aus der Konfrontation historisch und generisch disparater Untersuchungsgegenstände resultieren. Zwar erfreuen sich Qualifikationsarbeiten, die Gryphius und Kleist im Titel führen, mittlerweile einer gewissen Beliebtheit,[4] nicht immer ist die Konjunktion der – sei es in einer geheimen ›Verwandtschaft‹, sei es im Kontrast oder in einer literaturgeschichtlichen Entwicklung verbundenen – Autoren dabei allerdings ganz einleuchtend. Hier hingegen entspricht sie mit strenger Folgerichtigkeit der systematischen Anlage der Arbeit. Denn die ›Figur des barocken Trauerspiels zwischen Gryphius und Kleist‹ bezeichnet durchaus kein diachrones Zwischen, das vielleicht gar die (oder eine) Geschichte des ›barocken Trauerspiels‹ von Gryphius an bis auf Kleist zu erzählen erlaubte. Sie zielt vielmehr auf eine »Grenze« (S. 14), die Gryphius und Kleist zusammenführt wie trennt, und die Harst als Grenze zwischen Repräsentation und Theatralität beschreibt. So stehen Repräsentation und Theatralität sich zunächst als die Untersuchung strukturierende Oppositionsbegriffe gegenüber: Setzt die eine zwingend die Möglichkeit strikter, mit ›Gesetzeskraft‹ befestigter Unterscheidung voraus, ›theatralisiert‹ die andere dieses Begehren der stabilen Differenz durch Mechanismen der ›Entscheidung‹. Äußert sich die eine im »Wille[n]« des Trauerspiels (S. 66), die Sphären von Sein und Schein, von Gut und Böse, von Märtyrer und Tyrann sauber zu dividieren, ›enttäuscht‹ die andere dieses Phantasma klarer Unterschiede, indem sie die Unterscheidung in den Wirkungsbereich des Scheins hineinzieht, mithin den Schein entgrenzt:
»Hier würde das Gesetz nicht die Szene rahmen und abgrenzen, sondern selbst Teil des Spiels, Produkt des sich in ihm verwirklichenden Begehrens sein: Es handelte sich um ein entgrenztes Theater, in dem das Gesetz eben nurmehr eine Rolle spielt und dessen Szene daher in einem unentschiedenen Schein steht.« (S. 20)
Das verführt freilich zu einer naheliegenden, sehr schlichten Identifikation: Wäre Gryphius’ Trauerspiel der ›Repräsentation‹ zuzuordnen, Kleists Schreiben als ›theatral‹ zu charakterisieren? Die Problematik ist, wie Harst darzulegen sucht, bei weitem komplexer: Auf der einen Seite zeitigt der »Wille« des Trauerspiels, insofern er auf die repräsentative Schließung des Systems der Unterschiede gerichtet ist, ›ungewollte‹ theatrale Folgeeffekte; auf der anderen Seite funktionieren Kleists Entgrenzungsverfahren nur in spezifisch repräsentativen Konstellationen. Die ›Figur‹ des barocken Trauerspiels wäre also gleichsam der ›Grund‹, vor dem die Theatralität Kleists Kontur gewinnt.
Entsprechend »flankier[en]« (S. 193) den Gryphius gewidmeten Hauptteil der Arbeit (»Figur«) zwei (freilich nicht minder ›zentrale‹) Kleist-Kapitel (»Fall« und »Erfüllung«), die sich der Analyse eben dieser Konstellationen widmen. Konkretisieren lassen sich letztere für den ersten Teil mit einem von Deleuze und Guattari geprägten Begriff als das »›Aussagegefüge[ ]‹« der ›Berliner Abendblätter‹, »das neben Redaktion und Publikum eben auch Nationaltheater und Zensur umfaßt« (S. 21). Mit Ifflands Berliner Nationaltheater und der Kleists Zeitungsprojekt bekanntlich arg zusetzenden Zensurbehörde gehen hier zwei Instanzen des Gesetzes, zwei Anwälte der Fixierung von Zeichenprozessen in ein Spiel ein, das Harst treffend als »Theaterkritik« analysiert. Als »Schreibstrategie« (S. 29) ist ›Theaterkritik‹ zugleich Kritik am Theater und theatrale Kritik, ein Versuch, das von höchster Stelle autorisierte Projekt, »dem Königreich Preußen im Nationaltheater eine Repräsentanz zu schaffen, deren Heiligkeit dank der Zensur zumindest im Sinne der Unantastbarkeit gewährleistet wäre« (S. 34), zu unterwandern – und zwar, indem die Theaterkritik gewissermaßen an der Funktionsbedingung von Zensur, nämlich der definitiven Trennung von Kritik und Objekt der Kritik, ansetzt: Schon der Verlauf des sogenannten ›Theaterskandals‹ vom 27. November 1810 unterläuft die Unabhängigkeit von ›Fall‹ und ›Sprechen über den Fall‹, wird doch das Ereignis, über das die ›Abendblätter‹ berichten, durch ihren Redakteur Kleist maßgeblich mitverursacht – eine signifikante »Rückkopplung von Redaktion und Publikum« (S. 35), die sich darüber hinaus geradezu als »mediale Strategie« (S. 35) der ›Abendblätter‹ geltend macht: Wenn fingierte Leserbriefe den Rückbezug auf dort gar nicht geäußerte Kritik ermöglichen, ja diese ins Leere gehende Referenz ihrerseits im Modus der kritischen Bezugnahme inszenieren, fallen Äußerung und Zurücknahme von Kritik im selben Sprechakt zusammen. Die (fingierte) Kritik von Kritik zerstört ihr Objekt in dem Moment, in dem sie es generiert und macht sich so für eine Zensur letztlich unangreifbar, die eine theatral aufgehobene Unterscheidung nicht zu fassen bekommt. Die Kehrseite der ›Theaterkritik‹ bildet indes eine unhintergehbare Zweideutigkeit, die sie dem Urteil verleiht. Zwischen ›echtem‹, ›authentischem‹ Lob und ironisch vorgebrachter Kritik lässt sich nicht mehr unterscheiden, wo auch die »›Wahrheit‹ des Textes [...] allein dank der Lüge« (S. 34) erscheint: »Lob« und sein »Gegensatz« (S. 35) – beide können sich im Aussagegefüge der ›Abendblätter‹ stets als Täuschung erweisen.
Dieser hier noch sehr konkrete Sinn von ›Theaterkritik‹ wird im Voranschreiten der Untersuchung durch Engführung mit dem Begriff des ›Gottesurteils‹ erheblich erweitert. In teils sehr kompakten Lektüren ausgewählter Anekdoten, des Essays ›Über das Marionettentheater‹ und der Erzählungen ›Der Findling‹ und ›Der Zweikampf‹, schärft Harst den Blick für die medialen Erscheinungsbedingungen von Transzendenz. Immer wieder, so fällt dabei auf, tauchen die medialen Eigenlogiken des Offenbarungsträgers (etwa im ›Griffel Gottes‹) die scheinbar eindeutigen Botschaften in ein theatrales Zwielicht, das eine endgültige Aussage darüber, was der Fall gewesen ist, unmöglich macht. Auf die Spitze getrieben wird dieses Verfahren im ›Zweikampf‹: Statt den Fall (genauer: das Nicht-stattgefunden-Haben des Falls) festzustellen, vervielfältigt das im ›Theater‹ des Zweikampfs sich verhüllende Gottesurteil den Fall bloß. Neben dem Fall Littegardes steht plötzlich auch der »Unfall« und »Zufall« Friedrichs zur Entscheidung – ohne allerdings im Gottesurteil abschließend entschieden zu werden:
»Entsprechend ist das Gottesgericht ein »Unfall«, der den Schein nicht auflöst, sondern in der produzierten Spiegelung (FallFall) ihn erst zur absoluten Unentscheidbarkeit radikalisiert. Diese ist jedoch nicht im Sinn beliebiger Ununterscheidbarkeit zu verstehen, sondern als Forderung der Unterscheidung unter Bedingung ihrer Unmöglichkeit.« (S. 56)
So wäre denn dem auf Repräsentation verpflichteten Trauerspiel auf der einen Seite eine Grenze gesteckt im Kleistschen Entzug des Falls. Die zweite ›Flanke‹ besetzt Harst mit der Aufhebung der Figur im Schein. Während der Fall unter Bedingungen der Repräsentation eine Unterscheidung zu begründen hat, die dem figuralen Muster von Verheißung und Erfüllung, Typos und Antitypos vorausgeht, bringen sich Fall und Erfüllung im ›Zerbrochnen Krug‹ wechselseitig hervor. Unmittelbar anschaulich wird dies am intertextuellen Erbe, das Richter Adam – »bereits als Name eine komische Figur« (S. 179) – mit sich führt: Er ist Repräsentant des Sündenfalls und dessen figuraler Aufhebung zugleich, wenn er den »leidgen Stein zum Anstoß« – mithin, in Anspielung auf 1 Petr 2,8, den Christus – »in sich selbst« (I, Vs. 5–6[5]) sucht, eine figürliche Figur, wenn man so will (S. 179). Ihre heilsverbürgende Funktion büßt die Figur damit selbstredend ein, zumal in einem Spiel, das den vor Gericht verhandelten Fall nur ›figürlich‹ zu rekonstruieren vermag – in Gestalt eines seltsam gestaltlosen Kruges, einer bloß scheinbar (mit dem Krug) ›zerbrochenen‹ Unschuld oder eines – vielleicht, vielleicht auch nicht – von links nach rechts wandernden, ödipalen Schwellfußes. Solche Detailbeobachtungen, die in der Kleist-Forschung freilich in Teilen bereits gemacht wurden, integriert Harst gekonnt in einer Lektüre, die auf die konsequente, nahe an die Unaufführbarkeit heranreichende Unanschaulichkeit des Stückes abhebt. Mit der Unanschaulichkeit der auf anschauliche Evidenz angewiesenen Figur gerät hier neben dem Fall auch die Erfüllung ins Wanken, nicht nur das ›Dass‹ des Sündenfalls von Adam und Eve, auch die Wiederherstellung von Unschuld rückt in den Bezirk unauflösbaren Scheins. Das hat Konsequenzen für die Gattung des Spiels: Denn trotz gemeinsamer Problemstellung mit dem Trauerspiel (Heilsversicherung und Unschuldsbeweis) verkehrt die »Virtualität des Falls« (S. 191) und ihrer Auflösung das Trauer- ins Lustspiel. »Der Sündenfall als unausweichliche Komödie vereinigt Gott und Teufel, kann Unschuld nur im Schein wiederherstellen.« (S. 190)
In diesen von der doppelten Grenze Kleist terminierten Umriss, der theatralen Verunsicherung von Fall und Erfüllung, fügt sich etwas, das Harst Trauerspiel nennt. Ergänzt man dies um die Erläuterung, dass man darunter weniger eine historische (etwa aus zeitgenössischen Poetiken rekonstruierte) Gattungsbezeichnung als vielmehr eine »Denkform« sui generis verstehen solle (S. 193), Lust- und Trauerspiel als »Extremformen« zu nehmen habe, »deren sich der Einzeltext in der Realisation seines Begehrens bedient« (S. 20), so stellt sich unwillkürlich die Vermutung ein, dass Harsts Untersuchung begrifflich näher an Walter Benjamins Trauerspiel-Buch operiert, als sich am terminologischen Usus einer Barockforschung zu orientieren, die in Teilen Benjamins Habilitationsschrift noch immer kaum mit der Kneifzange anpackt. Und tatsächlich besteht ein nicht geringes Verdienst von ›Heilstheater‹ darin, obschon es das andauernde Schisma[6] mit Sicherheit nicht auflösen kann (geschweige denn will), nichtsdestoweniger einen signifikanten Beitrag zur ›Völkerverständigung‹ von Barock- und Benjaminforschern zu leisten. Beides hängt (auch) mit der methodischen Zwiefältigkeit der Studie zusammen: In ihr korrespondiert dem oben beschriebenen Schema, das Harst als brillanten Arrangeur von Lektüren ausweist, die eminent textnahe, aufmerksame Analysearbeit der Einzelabschnitte. Die ›Denkform‹ Trauerspiel scheint, aus dieser Perspektive betrachtet, induktiv Profil zu bekommen und die gegen Benjamins Methodik und Erkenntnisinteresse vorgebrachten Vorbehalte mit skrupulöser Argumentation am Trauerspiel-Text (im historischen Sinne) zu kontern. Gleichwohl harmonisiert ein solcher Eindruck vorschnell die Reibungen, die sich zwischen Lektüre und Schema auch hier einstellen, und auf die ich gleich zu sprechen komme. Das Schema kann – naheliegenderweise – nicht ohne Rückwirkungen auf die Gestalt der ›Denkform‹ bleiben und markiert somit, gerade indem es ohne Zweifel eine theologische Problembearbeitung (als die sich das Trauerspiel gibt) exponiert, die Grenzen des eigenen Blickfeldes. Das ist unumgänglich. Die Frage wäre, welches Maß derjenigen Gewalt, die noch jede Lektüre kennzeichnet, sich hier kundtut.
Doch vorerst zur ›Figur‹ der ›Denkform‹ Trauerspiel. Von den Rändern der Studie her gesehen muss sie sich in einem ersten Schritt als das glatte Gegenteil der grenzüberschreitenden, scheinaffinen Schreibstrategie Kleists darstellen: Getragen vom »ostentative[n] Wille[n] zur Eindeutigkeit« (S. 66) tendiert das Trauerspiel zu klaren Grenzziehungen, die die Ermöglichungsbedingung seiner heilsversichernden Darstellungsintention bilden. Die Insistenz, mit der etwa in Gryphius’ ›Catharina von Georgien‹ der unumstößliche Entschluss der Protagonistin zum Martyrium modelliert, schließlich im rhetorisch erzeugten Ideal der ›Reinheit‹ und ›Keuschheit‹ bekräftigt wird, sei, so argumentiert Harst, symptomatisch für das Anliegen, in einer der Vergänglichkeit preisgegebenen Welt, einen Raum stabiler Bedeutung zu eröffnen. Nur das absolut Gute, an dessen evidenter, bühnenwirksamer Beglaubigung in der Figur des Märtyrers dem Trauerspiel deshalb gelegen ist, vermag schließlich die Umschlägigkeit der Bedeutungen, die gefährliche Nähe von Märtyrer und Tyrann, von Schuld und Unschuld zu arretieren. Im Extremfall des als Ehe mit dem himmlischen Bräutigam allegorisierten Märtyrertodes (bekanntlich eine Anlehnung an die Hohelied-Exegese) nimmt der Heilswille gar den Charakter einer »Rechtsverbindlichkeit« (S. 78) an: Wer sich dem paradoxen Reinigungsritual der Blutstaufe unterzogen hat, erwirbt – wie schlechterdings jeder Tote, der mit den Überzeugungsmitteln des findigen Rhetorikers als Nachfolger Christi glaubhaft gemacht werden kann – einen Anspruch auf »Teilhabe am Heil« (S. 78). Bis in die Feinheiten der elokutiven Form des Dramas – seinen Hang zur Parataxe, zur gleichmäßigen Stilhöhe, zur Antithese, der pathetischen Formel und dem Parallelismus – wirkt die »Heilsmechanik« (Alewyn) hinein: »Eben diese gedankliche Starre und der ihr entsprechende Wunsch nach Eindeutigkeit und Beständigkeit ist im Parallelismus als einem besonders auffälligen Stilmerkmal des Gryphius sedimentiert, das sein Vorbild in den erhabenen Tragödien Senecas findet.« (S. 93) Das Revival der älteren Stilanalysen von Richard Alewyn und Paul Stachel kann Harst in eine hochinteressante Deutung des Trauerspiels als »imitatio tragœdiæ« überführen (vgl. S. 84–96).
Sein vorzügliches Vergewisserungsinstrument findet das Heilstheater aber in der christlichen figura. An ihr gewinnt zudem jener Mechanismus besondere Anschaulichkeit, der das Oppositionssystem des Trauerspiels nolens volens in die theatrale Entgrenzung kippt, den mutmaßlichen Gegensatz von Repräsentation (Gryphius/ Trauerspiel) und Theatralität (Kleist/Lustspiel) dynamisiert: Seinen Platz auf der ›richtigen Seite‹ mag sich Karl I. im Carolus Stuardus wohl dadurch zu erstreiten suchen, dass er mit aller Macht in der figura Christi stirbt – das Trauerspiel gibt sich, wie man seit Albrecht Schöne weiß, jede erdenkliche Mühe, seine Majestät als imitator Christi vor die irdischen Richter zu führen. Tatsächlich erweist sich die Etablierung der figura bei genauer Lektüre allerdings als bewusster strategischer Spielzug des Königs und seiner Fürsprecher, das Heil, für das sie einzustehen beansprucht, als kontrolliert produzierbarer Effekt, mithin als wenig belastbarer Schein (vgl. S. 110). Mehr noch: Es zerbricht die ›Eindeutigkeit‹ des Trauerspiels an einer Paradoxie, die der von Karl bemühten figuralen Beziehung inhärent ist: Als schlagenden Beweis seiner Unschuld – freilich indisponible Voraussetzung der Nachfolge Christi – führt er die Unschuld der von ihm hingerichteten Widersacher Laud und Wentworth an. Somit ist »die Figur des königlichen Unschuldsopfers selbst […] an das von ihm begangene Unrecht gebunden, ja wird von ihm produziert, insofern seine Unschuld zunächst ein Abbild der Schuldlosigkeit Wentworths ist. Erst durch den ›Werkzeug‹ Wentworth kann Carolus zum Märtyrer werden.« (S. 114)
Dergleichen kluge Beobachtungen, stets kundig an den Stand der Forschung anschließend, ihn dabei in überaus originelle Wendungen treibend, sind es, die ›Heilstheater‹ zu einem starken, einem gelungenen Buch machen, zu einem, von dem über die spezialisierte Gryphius- oder Kleist-Forschung hinaus wichtige Anregungen ausgehen können: sowohl für eine allgemeine Poetik des Trauer- und Lustspiels als auch für das intrikate Wechselverhältnis von Theologie und Theater in der Frühen Neuzeit. Dass es Stoff zur Kontroverse birgt, ja seinerseits zum ›Stein des Anstoßes‹ taugt, hat weniger mit gewissen ›Rezeptionshürden‹ zu tun, die die Untersuchung aufbaut. So mögen sich die (›analytischer‹ gestimmten) Geister an der »bewußte[n] Mehrdeutigkeit« (S. 194) scheiden, mit der die Leitbegriffe ›Figur‹ (christliche figura, rhetorische Figur, Gestalt etc.) und ›Fall‹ (Sündenfall, Rechtsfall, Tatsache etc.) im Fortgang der Studie gebraucht werden. Terminologisches Schillern ist hier einerseits produktiver Reflex der Äquivokationen und Mehrdeutigkeiten ausbeutenden ›Objektsprache‹, könnte sich andererseits auf Überlegungen stützen, die für die Ebene wissenschaftlicher ›Metasprache‹ Bedeutungsüberschneidungen reklamieren.[7] Auch den Lebertran, den Harst dem einen oder anderen unkritischen Gryphius-Adepten mit zuweilen recht scharfen, nicht immer sachdienlichen Urteilen einschenkt (»weniger Eleganz und Raffinesse […] als die ›Kunstprosa‹ Cyprians«, S. 89; »der ›sermo humilis‹ der Evangelien und Apostelbriefe« werde bei Gryphius »zur erhabenen Rede ausgestopft«, S. 137), wird man schlucken können.
Auf Dunkelstellen der virtuosen Blickregie sich wechselseitig ›erhellender‹ und terminierender Textensembles verweist gleichwohl eine Unterscheidung, die Harst einführen, an der er festhalten muss, ohne sie im Rahmen der Arbeit (explizit) reflektieren zu können, weil sie sich gewissermaßen aus deren Grundarchitektur ergibt: Man bekommt sie in der erst einmal befremdlichen Formel »Verleugnung von Theatralität« (S. 193) zu greifen – laut Harst einer der auffälligen Züge seines ›barocken Trauerspiels‹: »[S]eine Repräsentation ist verleugnete Theatralität« (S. 13). Die »Konfrontation der Gryphschen Spiele mit ihren Grenzen hebt hervor, was das Trauerspiel mit aller Macht nicht sein will: Theatralisierung der Repräsentation als Überschreitung der mit göttlicher Autorität verbürgten Scheidung zwischen Schein und Sein.« (S. 193) Das ist nun in der Tat ›nur‹ Folge einer »Konfrontation« mit der Grenze Kleist, die sich durch Kleist gebrochen abzeichnende ›Figur‹ des Trauerspiels, schlechterdings ein aufschlussreiches optisches Spektakel. Die diese Figur erzeugende Figur – Harsts nicht umsonst in »Fall«, »Figur« und »Erfüllung« sich spaltende Arbeit – wiederholt damit strukturell und unvermeidlich jene Gewaltsamkeit, die sie an ihrem Gegenstand beobachtet: Soweit sie sichtbar ausstellt, ›unterdrückt‹ sie, weil anders ein Einrücken in die Figur nicht zu haben ist. So gibt sich die aus den Lektüren der Trauerspiele nicht mehr ableitbare Trennung von ›eigentlicher‹ Darstellungsintention und ›verleugneter‹ Nebenwirkung als ›Systemeffekt‹ zu erkennen, als Zerbrechen der Texte an der figural konstruierten ›Denkform‹. Der ›Wille‹ von ›Heilstheater‹, das figurale Schema zum eigenen Strukturprinzip zu machen, erzwingt es, ein Trauerspiel zu denken, das »Entgrenzung […] mit schwerem Ernst unterdrückt« (S. 193), dessen »gewaltsame Wunscherfüllung« bedingungslos »ernst gemeint« zu sein habe (S. 11) und dessen Theatralität sich nur im Zeichen ihrer Negation Bahn bricht: »Verleugnung« eben.[8] Das kann man und wird man ohne »Konfrontation« anders sehen.
Welche Zweifel sich ›von außen‹ am (offenkundig psychoanalytisch grundierten) Theorem des ›Verleugneten‹ und ›Unterdrückten‹ des Trauerspiels anmelden, zeigt sich – das überrascht nicht – am ›Unterdrückten‹ der Arbeit: Das sind einmal jene Textbeobachtungen, die allenfalls um den Preis einer (wahrlich) willkürlichen Unterscheidung noch den »ostentative[n] Willen zur Eindeutigkeit« (S. 66) bezeugen. Um es bei Andeutungen zu belassen: Die lapidare Bemerkung, dass Catharina von Georgien »sich bereits in den ersten Szenen« des Stückes »zum Sterben« entschlossen habe, ihr Martyrium ohne jedes »Ringen« antrete (S. 66), gerät durchaus in (unausgetragenen) Konflikt mit einem ganzen Strang der Gryphius-Forschung, der auf den instrumentellen Charakter des Martyriums im Trauerspiel, seine ›Politisierung‹ hinweist.[9] Inwiefern dann noch der Tod des Märtyrers (wenn er denn einer ist), die anschauliche Präsentation der Leiche, im Dienst besagten ›Willens‹ stehend, ›ungewollt‹ in Entgrenzung umschlägt, wäre gleichfalls in breiterem Kontext zu durchdenken: Zeugt nicht ein Kaiser Leo, der erschreckend wörtlich, noch dazu in einem »dreifache[n] Kalauer«[10], in der figura Christi, nämlich unter dem ›echten‹, leider nur zu ›unanschaulichen‹ Kreuz stirbt, ja durch seinen Tod ein Spiel der Deutungen entfacht, das ganz nachdrücklich im Stück ausgetragen wird, von einem anderen Trauerspiel? Von einem, dem der Schein nicht mehr schlicht im Tod zu überwindendes »Zeichen […] der Verworfenheit« wäre (S. 195)? Von einem, dessen Toleranzspanne für Ambivalenzen sich breiter ausnähme, das sich in der Folge jedoch der Umsetzbarkeit des Anspruchs, Heil mit den Mitteln des Theaters als gewiss vor Augen zu stellen, eben gar nicht mehr ›gewiss‹ sein wollte? Tritt man aus der ›Figur des barocken Trauerspiels‹ heraus, wird es am klügsten sein, bewusst keine Entscheidung zu treffen, was daran »Strategie«, was »Phänomen«[11] ist. Harsts ›Figur‹ muss sie treffen. Das ist es, was diese tatsächlich präzise zwischen Gryphius und Kleist platziert. Der ›schwere Ernst‹, den sie aus den Trauerspielen hebt, eine »Komik«, die »unfreiwillig« bleibt (S. 11), bis die Figur sich im Kleistschen Lustspiel »kaum mehr lustig[ ]« selbst auflöst (S. 179), wäre nicht zum wenigsten ihr eigener – und der des lesenden ›Willens‹, der sich in ihr bekundet.
[1] Über: Joachim Harst, Heilstheater. Figur des barocken Trauerspiels zwischen Gryphius und Kleist, München 2012, 216 S.
[2] Daniel Weidner, »Schau in dem Tempel an den ganz zerstückten Leib, der auf dem Kreuze lieget«. Sakramentale Repräsentation in Gryphius’ ›Leo Armenius‹. In: Daphnis 39 (2010), S. 287–312, hier S. 290. Ähnlich zur Polarisierung der Forschung das Resümee bei Franka Marquardt, Unerhört. Funktionen des Gebets in Andreas Gryphius’ ›Catharina von Georgien‹. In: Daphnis 37 (2008), S. 457–486, hier S. 457–463.
[3] Weidner, Sakramentale Repräsentation (wie Anm. 2), S. 292.
[4] Vgl. etwa die für Harsts eigenes Anliegen in vielem maßgebliche Vorläuferstudie von Christopher J. Wild, Theater der Keuschheit – Keuschheit des Theaters. Zu einer Geschichte der (Anti-)Theatralität von Gryphius bis Kleist, Freiburg i.Br. 2003, oder die teils komplementär zu lesende, parallel und unabhängig entstandene Dissertation von Barbara Natalie Nagel, Der Skandal des Literalen. Barocke Literalisierungen bei Gryphius, Kleist, Büchner, München 2012.
[5] Zitiert nach SW.
[6] Noch einmal sei Hans-Jürgen Schings’ vielzitierter Ordnungsruf, »Benjamin den Benjaminforschern und die barocken Trauerspiele den Barockforschern«, bemüht (Hans-Jürgen Schings, Walter Benjamin, das barocke Trauerspiel und die Barockforschung. In: Daß eine Nation die andere verstehen möge. Festschrift für Marian Szyrocki zu seinem 60. Geburtstag, hg. von Norbert Honsza und Hans-Gert Roloff, Amsterdam 1988, S. 633–676, hier S. 676).
[7] Zur ›Gestalthaftigkeit‹ der rhetorischen Figur vgl. beispielsweise Ralf Simon, Der poetische Text als Bildkritik, München 2009, bes. S. 251f.
[8] »Verleugnungen negieren Erfahrungen oder Einsichten, ohne sie jedoch ins Unbewusste zu verschieben« (Thomas Macho und Kristin Marek, Die neue Sichtbarkeit des Todes. In: Die neue Sichtbarkeit des Todes, hg. von Thomas Macho und Kristin Marek, München 2007, S. 9–21, hier S. 12). Harst gibt keine Auskunft, wie er den von Freud bis Derrida weithin diskutierten Begriff verstanden haben möchte.
[9] Vgl. exemplarisch Torsten W. Leine, Das Martyrium als Politikum. Religiöse Inszenierung eines politischen Geschehens in Andreas Gryphius’ ›Catharina von Georgien‹. In: DVjs 84 (2010), S. 160–175, hier S. 163–165, außerdem Albrecht Koschorke, Das Begehren des Souveräns. Gryphius’ ›Catharina von Georgien‹. In: Figuren des Europäischen. Kulturgeschichtliche Perspektiven, hg. von Daniel Weidner, Paderborn 2006, S. 149–162.
[10] Nagel, Skandal des Literalen (wie Anm. 4), S. 45. Nagel sieht in Leos Tod die »profanierte[ ] Version einer typologischen Struktur« realisiert (S. 46). Dass Harst weder auf den Leo Armenius noch auf Cardenio und Celinde zu sprechen kommt, gilt vor diesem Hintergrund als Aussage. Sie benennt die Grenzen der mit Kleist umrissenen ›Figur‹.
[11] Nagel, Skandal des Literalen (wie Anm. 4), S. 62.